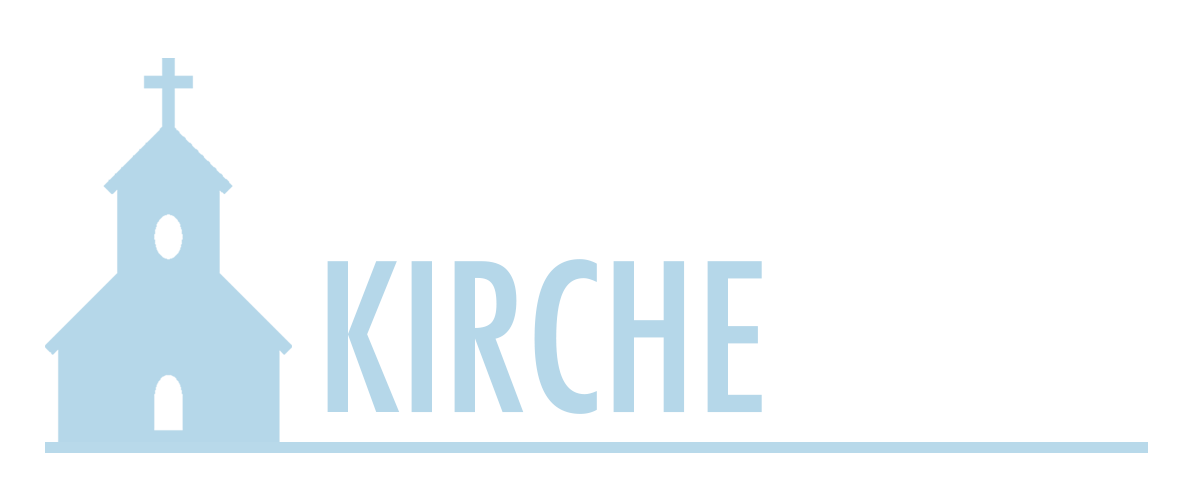Es ist vollbracht!
Johannes 19,30
Der Ruf des Siegers
„Es ist vollbracht!“ So lautet das vorletzte der sieben Worte, die uns aus dem Mund unseres gekreuzigten Heilands überliefert sind. Unmittelbar danach neigte der Herr sein Haupt und übergab den Geist. Der Evangelist Lukas berichtet, dass er dabei mit lauter Stimme rief: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!“ (Luk. 23,46).
Der Ausruf „Es ist vollbracht!“ besagt, dass die aufgetragene Aufgabe fertiggestellt worden ist. Jesu Tod am Schandpfahl meint also nicht, dass hier jemand gescheitert ist. Vielmehr brachte der Sohn Gottes seinen Auftrag zum Abschluss.
Vergleichen wir das einmal mit uns Sterblichen. Wenn ein relativ junger Mensch stirbt – ich denke an jemanden, der noch nicht das vierzigste Lebensjahr überschritten hat – haben wir oft den Eindruck, er sei mitten aus dem Leben herausgerissen worden. Wir bedauern seine Angehörigen und haben Mitleid mit ihm, denn so jemand scheint in seiner Lebensplanung gescheitert zu sein.
Aber selbst derjenige, der auf sieben oder acht Jahrzehnte zurückblicken kann, wird häufig erkennen müssen, dass vieles in seinem Leben unfertig liegen geblieben ist.
Jesus starb einen brutalen, gewaltsamen Tod. Doch der oben zitierte Ausruf bezeugt, dass Jesus Christus nicht gescheitert ist, sondern dass er den Auftrag ausgeführt hat. Er hat sein Werk abgeschlossen.
Aber, so fragen wir, stimmt das überhaupt? Gehört Jesus nicht zu denjenigen, die an den widrigen Umständen dieser Welt Schiffbruch erlitten haben? Denken wir an den Garten Gethsemane: Jesus fiel auf sein Angesicht. Er schwitzte Blut. Seine Jünger sanken in einen Tiefschlaf. Dann kam seine Gefangennahme, seine Fesselung, sein Verhör, seine Auspeitschung, die Erzwingung, sein Kreuz selbst tragen zu müssen, an das er dann genagelt wurde, an dem er ausrief: „Mich dürstet!“ und schrie: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Sind das nicht alles Belege dafür, dass auch Jesus gescheitert ist?
Tatsächlich lehrt das Wort Gottes, dass Jesus in gleicher Weise Anteil an Fleisch und Blut hatte wie wir Menschen. Entsprechend starb er einen Tod wie wir (Hebr. 2,14a). Aber das ist eben nicht die ganze Wahrheit.
Als der Sohn Gottes starb, trug er den Zorn Gottes. Er besiegte am Kreuz den, der die Macht des Todes hatte, den Teufel (Hebr. 2,14b). Sein Leiden und sein Sterben entsprachen also keineswegs dem Tod eines normalen Menschen. Vielmehr waren mit seinem Tod Dimensionen verbunden, die in ihrer Schrecklichkeit für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Sein Leiden und sein Sterben reichen in Abgründe hinab, die für uns unvorstellbar sind und sich deswegen auch nicht durch Filme darstellen lassen.
Der Ausruf „Es ist vollbracht!“ lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen Aspekt des Todes Jesu, der mit dem Sterben von uns Menschen in keiner Weise vergleichbar ist.
Jesus starb auch nicht aufgrund von Erschöpfung. Dass unser Heiland nicht wie andere Gekreuzigte an Entkräftung verendete, wird dadurch angedeutet, dass es dem römischen Hauptmann, der die Aufsicht über die Kreuzigung zu führen hatte, auffiel, wie schnell Jesus gestorben war (Mk. 15,44).
Die Evangelien geben uns in ihren Berichten über die letzten Stunden vor dem Tod Jesu immer wieder Hinweise darauf, dass der Sohn Gottes diese Zeit aktiv erlitt. Im Garten Gethsemane stand Jesus einer ganzen Kohorte von Soldaten gegenüber. Diese Schar war mit Fackeln versehen und mit Schwertern bewaffnet. Als sie erklärten, sie suchten Jesus, den Nazarener, antwortete dieser ihnen: „Ich bin es!“ Da stürzten sie zu Boden. (Joh. 18,5.6)
Als Petrus daraufhin sein Schwert zog, wies der Herr ihn in die Schranken. Er stellte seinem Jünger unter anderem die Frage: „Bist du nicht der Überzeugung, ich könnte jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken?“ (Mt. 26,53)
Wenig später stellte Pilatus Jesus die Frage: „Weißt du nicht, dass ich Macht habe dich zu kreuzigen und Macht habe dich freizulassen?“ Die Antwort Jesu bezeugt wahrlich nicht, dass der Herr sich als jemand sah, der den äußeren Umständen schicksalhaft ausgeliefert war: „Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre…„. (Joh. 19,10.11).
Dass Jesus nicht vor Erschöpfung starb, sondern sein Sterben ein aktives Handeln war, verkündete der Herr bereits einige Zeit vor seiner Passion: „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht es zu lassen und habe Macht es wieder zu nehmen.“ (Joh. 10,17.18).
Vor allem aber bezeugt seine Auferstehung am dritten Tage seine Überlegenheit über alle Umstände dieser todverfallenen Welt.
Gelegentlich verwenden wir bei Menschen, wenn wir von ihrem Sterben sprechen, das Wort „Hingehen“. Auch Jesus verwendete dieses Wort. Aber in seinem Mund klingt es energiegeladen. So kam es bei den Zuhörern auch an. Nachdem sie es aus seinem Mund vernommen hatten, fingen sie sogar an, darüber zu diskutieren, ob Jesus vorhabe, Selbstmord zu begehen (Joh. 8,22). Natürlich ging es unserem Herrn nicht darum. Aber deutlich ist: Jesus hatte bis zum letzten Atemzug alles unter seiner Kontrolle.
Wenn er von seiner „Verherrlichung“ oder von seiner „Erhöhung“ sprach, dachte er auch keineswegs nur an seine leibliche Auferstehung oder an seine Himmelfahrt, sondern auch bereits an seine Kreuzigung (siehe Joh. 12,23.32.33).
Um nicht missverstanden zu werden: Der Tod Jesu am Kreuz war für den Sohn Gottes äußerste Erniedrigung (Phil. 2,8). Er litt furchtbar! Sein Tod war etwas Entsetzliches! Aber angesichts einer seit dem Spätmittelalter verbreiteten „Karfreitagsfrömmigkeit“, in der man das Leiden Jesu und sein Sterben in sentimentaler Weise betrauert, bejammert, beklagt oder bemitleidet, sollten wir hören, dass Jesus selbst, gerade als er unter der Last seines Kreuzes zusammenbrach, den mitfühlend weinenden Frauen entgegnete: „Weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder…!“ (Luk. 23,28)
Halten wir fest: Durch das Furchtbare seines qualvollen Todes hindurch leuchtet Christi Herrlichkeit. Sein Ausruf „Es ist vollbracht!“, ist die Proklamation von jemandem, der gesiegt hat.
Es war und ist entsetzlich, dass Christus sterben musste. Aber es ist herrlich, dass es geschehen ist.
Rechenschaftsablegung
Aber was ist dort am Kreuz von Golgatha eigentlich „vollbracht“ worden? Man wird einwenden können, dass zum Zeitpunkt dieses Ausrufs dem Sohn Gottes noch sein Tod bevorstand. Auch seine Auferstehung, seine vierzig Tage danach erfolgte Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes lagen noch in der Zukunft. Auch sein Wirken im Lauf der Kirchengeschichte, in der er seine Gemeinde sammelt, nicht nur aus Juden, sondern auch aus den Heidenvölkern, seine Wiederkunft, in der er seine erwählten Heiligen zu sich nehmen und das Endgericht ausführen wird, stehen noch bevor.
Tatsächlich will Jesus mit diesem Ausruf nicht in einem absoluten Sinn zum Ausdruck bringen, dass nun alle Tätigkeiten beendet seien.
Als es am Ende der Sechs-Tage-Schöpfung über Gott heißt, er habe sein Schöpfungswerk „vollendet“ (1Mos. 2,1-3), wird damit auch nicht gesagt, dass er seitdem aufgehört habe, an seiner Schöpfung zu wirken. Das Wort Gottes lehrt vielmehr, dass er das All seitdem in seinem Sohn durch sein Wort trägt (Hebr. 1,3). Auch geht in gewisser Weise sein Schöpfungswerk weiter: Jeder von uns wurde von Gott geschaffen (vergleiche Ps. 139,13-16).
Gelegentlich kann man in Bibelkommentaren die Auffassung lesen, der Ausruf „Es ist vollbracht!“ sei das einzige der sieben Worte am Kreuz, das Jesus nicht an jemanden gerichtet hat. Ich halte diese Bemerkung nicht für richtig. Vielmehr wandte sich Jesus Christus mit diesem Wort an seinen Vater. Er legte damit Verantwortung ab.
Der Sohn Gottes griff hier eine Aussage auf, die er ziemlich zu Beginn seines irdischen, öffentlichen Wirkens gemacht hatte. Damals befand er sich auf der Reise durch Samaria. An einem Brunnen erklärte er seinen Jüngern: „Es ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.“ (Joh. 4,34). Genau dieses Werk Gottes seines Vaters, für dessen Erfüllung er auf diese Erde gesandt worden war, hat er nun vollbracht.
Auf seinem Gang in den Garten Gethsemane, als er zu seinem Vater betete, wies der Sohn erneut auf das ihm übertragene Werk hin: „Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll“ (Joh. 17,4). Genau dieses Werk war nun am Kreuz vollbracht.
Vergleicht man den Ausruf Jesu am Kreuz mit seiner Aussage in Samaria oder im Hohepriesterlichen Gebet, fällt auf, dass der Heiland dort von sich selbst spricht: Ich vollbringe das Werk bzw. habe es vollbracht. Im Unterschied dazu erfolgt der Ausruf des Herrn am Kreuz im Passiv: „Es ist vollbracht!„
Auf diese Weise tritt der Sohn völlig hinter das ihm aufgetragene Werk zurück: Natürlich hätte Christus auch hier sagen können: Schaut her: Ich habe das Werk vollbracht! Aber genau das tut er nicht. Insofern zeigt er sich als Knecht, dem es um die Erfüllung des erhaltenen Auftrages geht.
Vollbracht ist das Sühnewerk
Was aber ist dieses Werk genau, das Christus am Kreuz vollbrachte? Wenn wir auf den Zusammenhang achten, in dem der Apostel Johannes diesen Ausruf Jesu mitteilt, liegt es zunächst nahe, an die Erfüllung der Heiligen Schriften zu denken. Kurz vorher heißt es: „Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde…“ (Joh. 19,28). Offenbar blickt der Sohn Gottes in seinem Tun und Lassen bis zuletzt auf das geschriebene Wort der Wahrheit. (Vergleiche dazu auch: Joh. 19,24.36.37).
Aber der Grund, warum es Christus am Kreuz so deutlich um die Erfüllung der Schriften ging, lag daran, dass in diesen Schriften Gottes sühnendes Rettungswerk verheißen worden ist.
Jesus Christus, der „gemäß den Schriften“ als Lamm niedergebeugt, verwundet, zerschlagen, misshandelt, geschlachtet und begraben wurde (Jes. 53,4-9), erfüllte durch sein Leiden und durch sein Sterben das ihm vom Vater aufgetragene Werk. Dieses Werk bestand im Kern darin, dass er sein Leben zum „Schuldopfer“ darbrachte (Jes. 53,10). Der Mittler zwischen Gott und den Menschen sühnte vor Gott die Sünden seines Volkes (Hebr. 2,17.18).
Damit fasst dieses sechste Kreuzwort die gesamte Heilsgeschichte zusammen und verkündet deren Erfüllung. Das Wort „Es ist vollbracht!“ ist gleichsam die Klammer, die den Beginn und das Ende der Geschichte zusammenhält.
Es begann in der Ewigkeit, als der Vater den Heilsratschluss in seinem Sohn fasste. Nach dem Sündenfall ging es weiter mit der Kriegserklärung Gottes: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau.“ (1Mos. 3,15). Wenn einst das Neue Jerusalem mit dem Lob und dem Jubel Gottes erfüllt ist, wird nie endend der Ruf erschallen: Das Lamm, das das Werk Gottes vollbracht hat, ist würdig, zu empfangen Ruhm, Ehre, Preis und Anbetung.
Was in der deutschen Sprache drei Worte sind („Es ist vollbracht„) ist im Griechischen ein einziges Wort. Wohl kein Wort ist für den Teufel und sein Reich vernichtender. Kein Wort hat umgekehrt mehr das Wohlgefallen des Vaters gefunden als dieser Ausruf. Denn darin ist offenbar, dass für das geschändete Recht Gottes vollkommene Genugtuung geleistet worden ist.
Friedenserklärung
Gelehrte, die das Neue Testament ins Hebräische übersetzten, haben das griechische Wort, für das in der deutschen Sprache „Es ist vollbracht“ steht, ebenfalls mit einem einzigen Wort übersetzt. Es ist das Wort „nischalam„. In diesem Wort ist das bekannte Wort Schalom enthalten. Die Übersetzer haben verstanden: „Es ist vollbracht“ heißt so viel wie: Nun herrscht Friede!
Allen Angefochtenen, Verzagten, allen die sich mit der Frage quälen, wie sie Heilsgewissheit erlangen, gilt diese Friedenserklärung vom Kreuz.
Indem wir von uns selbst wegblicken hin auf das vollbrachte Versöhnungswerk am Kreuz auf Golgatha, das der Vater durch die Auferweckung seines Sohnes nach drei Tagen ein für allemal besiegelte, erfassen wir im Glauben den Gnadenbund, der im vergossenen Blut Christi unerschütterlich feststeht. Wir wissen: Wenn Gott der Vater mit dem Werk seines Sohnes Frieden hat, dann können wir es auch haben. Denn dann kommt Gott selbst über den Abgrund auf der Brücke, die er selbst geschaffen hat, zu mir und schließt mich in sein Vaterherz.
Mit dem Ausruf „Es ist vollbracht!“ will Jesus keineswegs sagen: Ich habe meinen Teil getan, nun gehe ich zum Vater, und jetzt seid ihr an der Reihe, um das Weitere für eure Errettung zu erledigen. Er verkündet hier nicht: Ich habe nun die Segnungen der Errettung möglich gemacht, und nun müssen die Menschen sich so konditionieren, dass sie kraft ihres freien Willens ihre Errettung auch verwirklichen.
So zu denken wäre ein riesiges Missverständnis! Unser Herr und Heiland hing keineswegs am Kreuz, unsicher darüber, wer gerettet wird. Vielmehr ist er in seinem Rettungswerk souverän. Noch kurz vorher hatte sich der Sohn Gottes an den Vater gewandt und ausdrücklich gebetet „nicht für die Welt, sondern für die, die du mir aus der Welt gegeben hast“, also für seine Jünger und für alle diejenigen, die durch die weitere Verkündigung an ihn glauben werden (Joh. 17,6-9.20.24).
Unmittelbar im Anschluss an diesen Ausruf Jesu berichtet Johannes: „Und er neigte sein Haupt und übergab seinen Geist“ (Joh. 19,30b). Dass der Herr sein Haupt neigte, besagt indirekt, dass er bis zu diesem seinem Todeszeitpunkt sein Haupt aufrecht hielt.
Am Kreuz verendete nicht eine durch die äußeren Umstände gescheiterte Existenz, sondern hier starb einer, der zu seinem Vater emporblickte und mit seinem Ausruf, „Es ist vollbracht!„, seinen ihm vor Ewigkeiten her gegebenen und für alle Ewigkeiten gültigen Auftrag als erfüllt proklamierte.