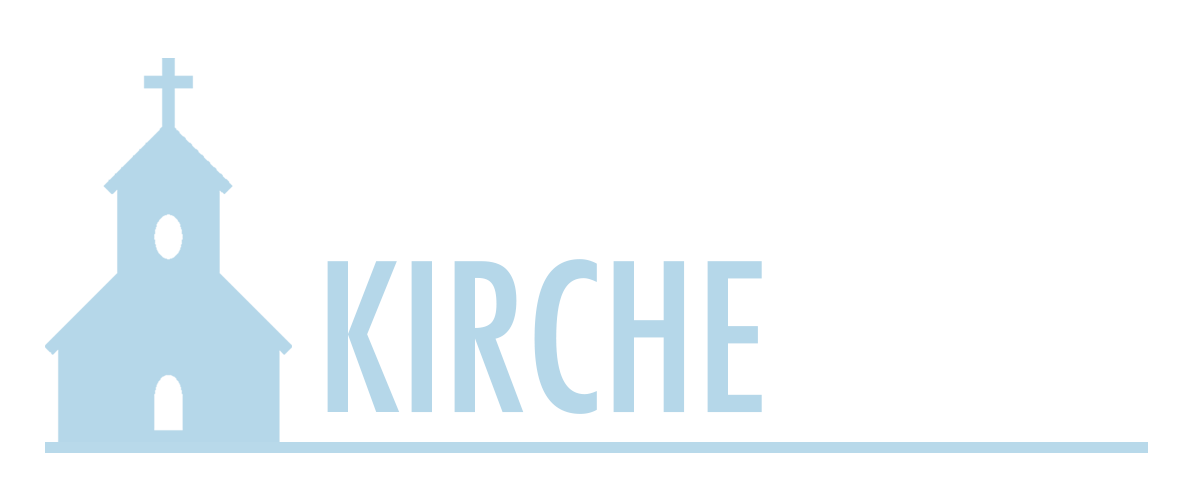Teil 1/3 der Serie: Künstliche Intelligenz: der digitalisierte Turmbau zu Babel
In einer Welt, die von technischen Innovationen in atemberaubendem Tempo vorangetrieben wird, hat die Künstliche Intelligenz (KI) in kürzester Zeit eine bemerkenswerte Stellung eingenommen. Die Bewertung der künstlichen Intelligenz ist komplex und polarisiert die Meinungen. Während optimistische Enthusiasten die KI als Allheilmittel feiern, das viele der komplexesten Probleme über Nacht lösen kann, warnen Kritiker vor unerwarteten katastrophalen Auswirkungen, die durch den uneingeschränkten und leichtsinnigen Gebrauch der neuen Technologie entstehen könnten.
Für den christlichen Denker stellen diese Entwicklungen eine ernstzunehmende Herausforderung dar, da er sich die Frage stellen muss, wie er die Entwicklungen und die Debatten darüber aus christlicher Sicht einordnen soll. Bereits jetzt ist absehbar, dass die KI früher oder später viele Aspekte seines Lebens und des Lebens der Kirche beeinflussen wird. Das macht eine sorgfältige und zeitnahe Auseinandersetzung mit diesem Thema notwendig.
Ein Überblick
In der vorliegenden dreiteiligen Artikelreihe wird die theologische Dimension der KI-Problematik erforscht, mit einem besonderen Fokus auf die Einordnung dieses Phänomens innerhalb einer biblischen Weltsicht. Da Künstliche Intelligenz über rein technische Aspekte hinausreicht und grundlegende – im Kern religiöse – Fragen über das Wesen menschlicher Intelligenz berührt, handelt es sich um eine grundlegende Frage des menschlichen Selbstverständnisses, die nicht größtenteils den Technikern überlassen werden sollte.
Der erste Artikel dieser Reihe dient als Einführung in das Thema Künstliche Intelligenz und erforscht die grundlegende Frage, wie KI die Komplexität der Realität vereinfacht, um Berechnungen durchführen zu können. Außerdem geht es um die Grenzen der KI.
Der zweite Artikel wird sich mit der anti-christlichen Ideologie auseinandersetzen, die der ideologischen KI-Bewegung zugrunde liegt – insbesondere in ihrem Bestreben, eine wahre künstliche ‚Superintelligenz‘ zu entwickeln.[1]
Der dritte Artikel wird schließlich eine christliche Bewertung der Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz skizzieren mit besonderem Fokus auf die Schwächen der menschlichen Natur. Dabei soll auch das Potenzial dieser Technologie – sowohl für gute als auch für böse Zwecke – unter die Lupe genommen werden.
Das Ziel dieser Artikelserie ist es, eine ausgewogene, aber dennoch klare Position einzunehmen, das heißt, die Technologie weder zu verteufeln noch zu überschätzen. Ähnlich wie bei der Kernkraft liegt der Unterschied in der Anwendung, wobei die moralische Verantwortung umso größer wird, je mächtiger die Entdeckung ist.
Die Heilige Schrift bietet uns eine klare Orientierung, indem sie uns die Quelle aller Intelligenz und Ordnung offenbart. Unser menschliches Wissen und Handeln haben klare Grenzen, und mit Macht kommt Verantwortung, für die Weisheit erforderlich ist. Ein Christ ist nicht passiv und lässt sich nicht von allem beeindrucken, sondern das Licht der Schrift gibt ihm die Mittel, die Zeichen der Zeit zu deuten und sich in seiner Umwelt zurechtzufinden (Spr 14,15). Diese Weisheit bleibt auch in einer Ära digitaler Innovationen von wesentlicher Bedeutung, indem sie uns auffordert, über technische Entwicklungen kritisch nachzudenken und diese im Lichte der Offenbarung zu bewerten.
Was ist Künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Algorithmen und Modellen beschäftigt, die Computern ermöglichen, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Diese Aufgaben gehen weit über das bloße Ausführen von Anweisungen in vorgegebenen Codes hinaus. KI-Systeme können Texte analysieren, Bilder erkennen, Sprachmuster verstehen und sogar eigenständige Entscheidungen treffen – oder zumindest den Anschein davon erwecken. Begriffe wie Verstehen, Erkennen oder Entscheiden stammen dabei ursprünglich aus der menschlichen Erfahrung und werden metaphorisch auf Computer übertragen. Doch was steckt dahinter?
Ein zentraler Bestandteil der KI ist das maschinelle Lernen, das Algorithmen umfasst, welche es Computern ermöglichen, aus Daten zu lernen und Muster zu erkennen. Durch Erfahrung verbessern sich diese Algorithmen kontinuierlich und können Vorhersagen machen oder Entscheidungen treffen, ohne dass eine explizite Programmierung erforderlich ist. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Fähigkeit ist die Sprachverarbeitung, bei der Computer in der Lage sind, menschliche Sprache zu analysieren, zu verstehen und sogar selbst zu generieren. Durch ChatGPT von OpenAI wurde dieser Aspekt der KI in den letzten Jahren der breiten Masse zugänglich gemacht.
Große Technologieunternehmen wie Google, Meta (ehemals Facebook) und X (ehemals Twitter) spielen eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von KI-Modellen. Sie investieren beträchtliche Mittel in die Forschung und Entwicklung von KI und maschinellem Lernen. Als Marktführer in diesem Bereich hat aber OpenAI wesentliche Durchbrüche bei der Entwicklung von Sprachmodellen sowie weiterer KI-Technologien erzielt.
Wie arbeitet Künstliche Intelligenz?
Diese IT-Unternehmen verfügen über riesige Datenmengen, die aus verschiedenen Quellen stammen, darunter Text- und Sprachnachrichten, Bilder und Videomaterial. Diese Daten sind entscheidend für das Training und die Verbesserung von KI-Modellen. Mithilfe von leistungsstarken Rechenzentren und fortschrittlichen Algorithmen analysieren sie die gesammelten Daten, um wiederkehrende Muster und allgemeine Strukturen zu erkennen. Diese Analysen ermöglichen es den Unternehmen, ihre Dienste zu verbessern und neue Anwendungen zu entwickeln. Beispiele hierfür umfassen personalisierte Empfehlungen, automatisierte Übersetzungen sowie fortschrittliche Bilderkennungssysteme und die KI-gestützte Generierung von Videos auf Grundlage textbasierter Anweisungen, auch bekannt als Prompts, die in natürlicher Sprache formuliert werden. Die Fortschritte im maschinellen Lernen und in der KI haben das Potenzial, viele Bereiche unseres Lebens zu revolutionieren – von der Medizin über den Transport bis hin zur Unterhaltung.
In diesem Kontext kann Künstliche Intelligenz als eine Form der angewandten Statistik angesehen werden, bei der die Wahrscheinlichkeiten von Sequenzen von Wörtern oder allgemein von Mustern berechnet werden. Im Bereich der Sprachverarbeitung werden beispielsweise Wahrscheinlichkeiten von Worten oder Wortgruppen ausgerechnet, um Muster in der menschlichen Sprache zu erkennen. Bei der Analyse von Bildern und Videos werden Cluster (Strukturen mit ähnlichen Eigenschaften) von Pixeln identifiziert, die sich mit vorhersehbarer Wahrscheinlichkeit in bestimmten Mustern anordnen.
Diese Mustererkennung basiert auf der Tatsache, dass Menschen häufig ähnliche Aussagen treffen, ähnlich reagieren oder ähnliche Antworten auf Fragen geben und dass Bilder von Landschaften, Gesichtern usw. viele Ähnlichkeiten aufweisen. KI-Modelle nutzen große Datenmengen, um diese Muster zu erkennen und zu verallgemeinern. Durch das Training an umfangreichen Datensätzen können die Algorithmen lernen, neue, unbekannte Daten zu interpretieren und Vorhersagen zu treffen.
Strukturen und Muster in Gottes Schöpfung und im menschlichen Verhalten
Gottes Schöpfung zeigt uns, dass Ordnung und Muster in der Natur eine fundamentale Rolle spielen. So finden wir in der Natur eine Vielzahl von Mustern, die sich wiederholen und somit den Menschen helfen, Gottes Schöpfung zu verstehen. Auch der Mensch selbst lebt in einem Rahmen von Gewohnheiten und mustergemäßen Verhaltensweisen. Schon bei der Schöpfungsgeschichte wird uns dies beispielsweise gezeigt, als Gott die Tiere zu Adam brachte, damit er sie benennen würde (1Mos 2,19). Die Namen, die Adam den Tierarten gab, spiegelten nicht nur ihre äußeren Eigenschaften wider, sondern auch ihre Charaktereigenschaften.[2] Die Anzahl dieser Wesenseigenschaften war sicherlich sehr groß, aber für den ersten Menschen immer noch überschaubar.
Unsere Sprache verfügt über eine enorme, aber dennoch begrenzte Anzahl von Wörtern sowie eine Vielzahl möglicher, aber auch sinnvoller Sätze. Das meiste, was wir in unserem Leben sagen oder tun, folgt einer überschaubaren Anzahl von Ideen, Satz-Strukturen und Verhaltensweisen. Selbst ohne technische Hilfsmittel ist es keine Unmöglichkeit, durch systematische Beobachtung nach einer gewissen Zeit das Verhalten, die Ausdrucksweise oder die Präferenzen eines anderen Menschen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Wir sind in gewissem Maße alle Geschöpfe der Gewohnheit.
Dank der kostenlosen Plattformen sozialer Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und anderen haben jene Unternehmen nun Zugang zu digitalisierten menschlichen Verhaltensweisen in Form von Nachrichten, Fotos und Videos. Die enorme Menge an Informationen, die die Internet-Generation durch Chats, Blog-Beiträge und andere Formen ausgetauscht hat, ist beeindruckend. Diese Informationen sind zwar nicht restlos vollständig, aber groß genug, um klare Strukturen dank der Kraft der Gewohnheit und der sozialen Konventionen im Ausdruck, im Verhalten und im Denken zu erkennen.
Die festen Gewohnheiten, die in unserem Verhalten zu entdecken sind, haben zwei Gründe. Erstens, unsere begrenzte menschliche Natur schränkt uns in diesem Sinne ein. Wir können uns nicht unendlich verändern, sondern wir haben einen festen Charakter und Gewohnheiten. Wir können vielseitig und spontan sein, aber wir sind nie völlig unberechenbar. Diese Beschränktheit hat zweitens auch eine moralische Dimension, die sich aus unserer Neigung zur Faulheit aufgrund unserer sündigen Natur ergibt.[3] Dadurch nutzen wir das ursprünglich in uns liegende Potenzial und die Vielfalt nie vollständig aus, was dazu führt, dass unsere Reden und Handlungen noch schematischer und vorhersehbarer werden.
Die Illusion der Künstlichen Intelligenz
Für viele von uns ist es eine fast unheimliche Erfahrung, wenn man mit einem KI-Chatbot interagiert, als ob es sich um eine echte Person handeln würde. Wenn man den KI-Chatbot auf einfache Weise fragt: „Hallo, wie geht es dir?“ und als Antwort nicht nur eine Rückmeldung, sondern auch eine Gegenfrage erhält, entsteht schnell der Eindruck, tatsächlich mit einem intelligenten Wesen im Gespräch zu sein. Diese menschliche Schwäche hat dazu geführt, dass es bereits ganze Websites gibt, auf denen man mit verschiedenen KI-‚Personen‘ Gespräche führen kann. Das Zusammenfassen oder Weiterschreiben von Texten mag wie eine Demonstration von Intelligenz wirken, basiert jedoch letztlich auf angewandter Statistik. Die Illusion der Intelligenz entsteht vor allem dann, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass bereits eine gigantische Menge an Informationen zu verschiedenen Themen digitalisiert und ausgewertet wurde.
Wahrscheinlichkeit und Tokens
Die hier diskutierte Intelligenz besteht aus einem Teil der zusammengetragenen, digitalisierten menschlichen Intelligenz, die durch statistische Verfahren zu neuen Erkenntnissen und Anwendungsfällen zusammengeführt wird. Es bleibt jedoch umstritten, ob diese Form der Intelligenz tatsächlich als solche bezeichnet werden kann, oder ob sie lediglich Wahrscheinlichkeitsspiele sind. Der Anfangspunkt dieser ‚Intelligenz‘ liegt in den Eingangsdaten, die für das Training dieser KI-Modelle eingesetzt werden. Wörter oder Subwörter werden in numerische Repräsentationen, sogenannte Tokens, umgewandelt. Dieser Prozess beginnt mit der Textvorverarbeitung, bei der der Eingabetext standardisiert wird, gefolgt von der Tokenisierung, bei der der Text in kleinere Einheiten zerlegt wird. Diese Tokens werden dann in eindeutige numerische Werte (Indizes) umgewandelt, die in einem Vokabular gespeichert sind. Anschließend werden diese numerischen Tokens in Vektoren (Embeddings) umgewandelt, die in einem hochdimensionalen Raum liegen und die semantischen und syntaktischen Eigenschaften der Tokens repräsentieren. Beispielsweise wird analysiert, wie häufig das Wort ‚wie‘ in Verbindung mit ‚geht‘ vorkommt. Statistisch gesehen tritt diese Kombination sehr häufig auf. Dennoch bleibt die Frage, ob durch diese Methode wesentliche Aspekte der menschlichen Sprache und des Kontextes verloren gehen.
Intelligenz und Ebenbild
Es gibt auch einen theologischen Grund, der gegen die Bezeichnung Künstliche Intelligenz spricht. Unser Verstand und unsere Intelligenz sind wesentliche Bestandteile der Tatsache, dass wir als Menschen Bilder Gottes sind [4]. Gott hat kein anderes Lebewesen mit einer solchen Fähigkeit ausgestattet, die es ermöglicht, zu reflektieren, zu verstehen und zu planen wie der Mensch. Durch unsere Intelligenz sind wir in der Lage, Gottes Wort zu verstehen. In diesem Kontext kann Intelligenz als eine göttliche Eigenschaft betrachtet werden, das uns als eine ehrenvolle Gabe von Gott geschenkt worden ist. Wenn wir nun behaupten, dass der Mensch selbst Intelligenz erschaffen kann, dann riskieren wir, die wahre Natur der Intelligenz, insbesondere ihre geistige Komponente, zu übersehen und ihren göttlichen Ursprung sowie ihre göttliche Gabe in Frage zu stellen. Wie wir im zweiten Artikel noch ausführlich sehen werden, basiert eine solche Sichtweise auf einer evolutionären Weltanschauung, die versucht, alles aus dem Materiellen abzuleiten.
Wir sollten nicht etwas als Intelligenz bezeichnen, was nicht im vollen Sinne intelligent ist, sondern vielmehr angewandte Statistik darstellt. Wenn wir von Intelligenz reden, meinen wir unsere Ehre als Mensch und als Ebenbild Gottes. Wenn wir diesen Begriff auf einen von Menschen erschaffenen Algorithmus anwenden, entehren wir den Schöpfer und geben falsches Zeugnis nach dem neunten Gebot (2Mos 20,16).
Die Grenzen der Künstlichen Intelligenz
Ist nun ein Text wirklich nur die Ansammlung von Wörtern und die mathematische Zusammensetzung von Wörtern? Hatte der griechische Mathematiker Pythagoras (ca. 570-495 v. Chr.) doch Recht, dass alles nur Zahl ist?
Nein, denn die Sprache ist mehr als nur die mathematische Zusammensetzung von Wörtern. Gesprochene Sprache hat eine menschliche Wärme, die man mit der Verschriftlichung nur teilweise abbilden kann. Ein von Menschen verfasster Text hat einen bestimmten menschlichen Charakter, der sich nicht durch mathematische Formeln oder Berechnungen erfassen lässt. Es ist nicht möglich, einen ‚perfekten‘ Text zu definieren, weil in der Sprache Perfektion nur als grammatikalische Größe, aber nicht als ästhetische oder inhaltliche Größe definierbar ist. Man kann statistisch einen gewissen Stil eines Autors imitieren, aber man kann keinen authentisch neuen Text schaffen. Denn jeder Text ist mehr als die Summe seiner Wörter.
Kann man alles digitalisieren?
In der Auslegung der Heiligen Schrift und der Behandlung theologischer Themen kann die mathematische Methode nur einen begrenzten Aspekt des Textes aufzeigen. Texte und Sprache sind von Natur aus analog und nicht mathematisch präzise. Analog bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Wörter und Sätze sich nur bis zu einem gewissen Grad in mathematische Formen oder Modelle übertragen lassen, da sie komplexe Bedeutungen, Kontexte und Nuancen enthalten, die nicht vollständig durch Zahlen erfasst werden können. Der moderne wissenschaftliche Mensch bevorzugt die mathematische Darstellung der Welt, da sie ihm die Illusion absoluten Wissens vermittelt. Wissenschaftliches Wissen in mathematischer Form gibt vor, objektiv zu sein. Dieser Anspruch kann durch analoge Sprache nicht widerlegt werden. Aus unserer Sicht liegt hier das zentrale Problem der Wissenschaftsphilosophie, wenn sie nach Wahrheit fragt.
Gott schuf ein Universum, das nur bis zu einem bestimmten Grad mit mathematischen Mitteln erfassbar und messbar ist. Es existiert jedoch eine enorme Bandbreite von Wahrheit, die jenseits der Reichweite der Mathematik, Statistik und künstlichen Intelligenz liegt: die Welt des Geistes. Wie lassen sich beispielsweise die Schönheit der Musik, seelisches Heil, Hoffnung, Schuld und Sünde in einem mathematisch-wissenschaftlichen Kontext fassen? Diese Realitäten erkennen wir mit unserer Intelligenz, jedoch lediglich, indem wir uns ihnen mit unserem Verstand annähern. Und dennoch sind sie wahrhaftig. Ähnlich ist es mit der Digitalisierung von Bildern und Tönen: Es handelt sich um eine wunderbare Annäherung an die Realität, bei der jedoch ein Teil der ursprünglichen ‚Information‘ verloren geht.
Fazit: Der Schein von Intelligenz führt letztlich zur Tyrannei
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine unglaubliche Vermessenheit des Menschen ist, auf der Basis eines Ausschnitts der gesamten Schöpfungsrealität durch Auffinden von Mustern und Strukturen eine ‚Intelligenz‘ schaffen zu wollen. Denn bereits zuvor hat man einen großen Teil der Information als nicht relevant für die Intelligenz heruntergestuft.
Ich möchte damit auf keinen Fall die Nützlichkeit der KI infrage stellen, sondern sie nur richtig einordnen. Der Mensch ist nicht in der Lage, etwas künstlich zu erschaffen, das geistiger Natur ist. Dieses Missverständnis resultiert aus einer eingeschränkten Sichtweise auf den menschlichen Geist, die ein Ausdruck der verdorbenen Frucht des rationalistischen, wissenschaftlichen Weltbildes unserer Zeit ist. KI ist in diesem Sinne die aktuellste Form dieser ‚Wissenschaftsgläubigkeit‘, die (scheinbar) unglaubliche Taten vollbringen kann, aber auf dem Weg dahin die Seele verliert. Wie Christus sagt: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? (Mt 16,26).
Eine eingeschränkte Perspektive auf die Realität
Die große Gefahr liegt somit in der Vermischung. Einerseits ist KI in verschiedenen Bereichen unbestreitbar nützlich. Andererseits verfügt das Weltbild dahinter über eine sehr eingeschränkte Sicht der Schöpfungsordnung. Man vermischt dabei Vernunft, Seele und Geist, wobei der Mensch nicht nur denkt, sondern auch fühlt, glaubt usw. All das ist seine Intelligenz. Diese allgegenwärtige begrenzte Perspektive hat eine so weitreichende Verbreitung, dass viele Menschen das Gehirn zunehmend als einen Computer betrachten.
Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der Aussage, dass das Gehirn in bestimmten Aspekten Regeln befolgt (ähnlich wie ein Computer) und der Behauptung, dass das Gehirn lediglich ein langsamer ‚Computer‘ ist, der nun durch Künstliche Intelligenz ersetzt wird.
Die mathematische Darstellung durch Digitalisierung von Text, Bild und Video ist nur bis zu einem gewissen Grad wahr. Es fehlen aber viele andere Dimensionen. KI hat die eingeschränkte wissenschaftliche Perspektive eingenommen, die die gesamte Wirklichkeit auf Zahlen reduziert. Der Geist und Wille des Menschen werden auf einen Algorithmus reduziert, bei dem der Mensch einen Parameter optimiert, wie etwa Glück oder Geld. Bereits der Utilitarismus von Jeremy Bentham, einem britischen Philosophen und Juristen (1748-1832), vertrat diese Weltsicht.
Wenn man diese Perspektive akzeptiert, verlieren Werte wie Freiheit, Glaube, Ehre und Liebe ihre tiefere Bedeutung. Der Mensch wird auf eine Art Maschine reduziert. Eine dystopische Welt, in der die künstliche Intelligenz allein herrscht, ist vorstellbar: eine perfekt organisierte Gesellschaft mit unglaublicher Effizienz, in der der Mensch jedoch nur noch wie eine Ameise ‚funktioniert‘ und berechenbar sein muss, weil alles auf messbare Größen wie Wirtschaftskraft, Profit und IQ reduziert wurde. Möge uns Gott vor diesem Wahnsinn bewahren!
Ausblick auf den zweiten Artikel
Im nächsten Artikel dieser Reihe werden wir auf die dunklere Seite der akademischen KI-Bewegung eingehen, die versucht, eine künstliche ‚Superintelligenz‘ zu schaffen. Hinter diesem Konzept steht die evolutionäre Idee einer stetig sich perfektionierenden, völlig auf diese Welt beschränkten und höheren Intelligenz, die jedoch in ihrem Wahn die tatsächliche Schöpfungsordnung und ihre Grenzen völlig außer Acht lässt. Diese Ideologie stellt eine ernsthafte Bedrohung für die menschliche Würde und unserer Freiheiten dar. Es ist wichtig, dass wir als Christen diese Entwicklungen kritisch hinterfragen und uns bewusst machen, welche Werte und Prinzipien wir verteidigen wollen.
Weiterführende Literatur
Lennox, John: 2084 – Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Holzgerlingen [SCM Hänssler] 2022.
Reinke, Tony: Von Arche, Babel und KI. Eine biblische und praktische Theologie der Technik. Augustdorf [Betanien] 2025.
Didier Erne arbeitet als Berater in der Finanzwelt und hat an der Universität Genf Wirtschaftswissenschaften und an der Faculté Jean-Calvin in Aix-en-Provence reformierte Theologie studiert. Mit seiner Frau Michelle und seinen drei Kindern gehört er der Presbyterianischen Gemeinde Zürich an.
- Der technische Begriff ist AGI (Artificial General Intelligence), eine hypothetische Form von Künstlicher Intelligenz, die in der Lage ist, jede intellektuelle Aufgabe zu bewältigen, die ein Mensch ausführen kann. Sie könnte theoretisch zu einer Superintelligenz führen, die menschliche Fähigkeiten weit übertrifft.
- Riede, Peter: Im Spiegel der Tiere. Studien zum Verhältnis von Mensch und Tier im alten Israel. Freiburg/CH [Universitätsverlag] 2002, S. 4 ff
- Siehe beispielsweise Sprüche 6,6-11 und Matthäus 25,26
- Siehe beispielsweise Sprüche 2,6 und Matthäus 22,37.[JK1]