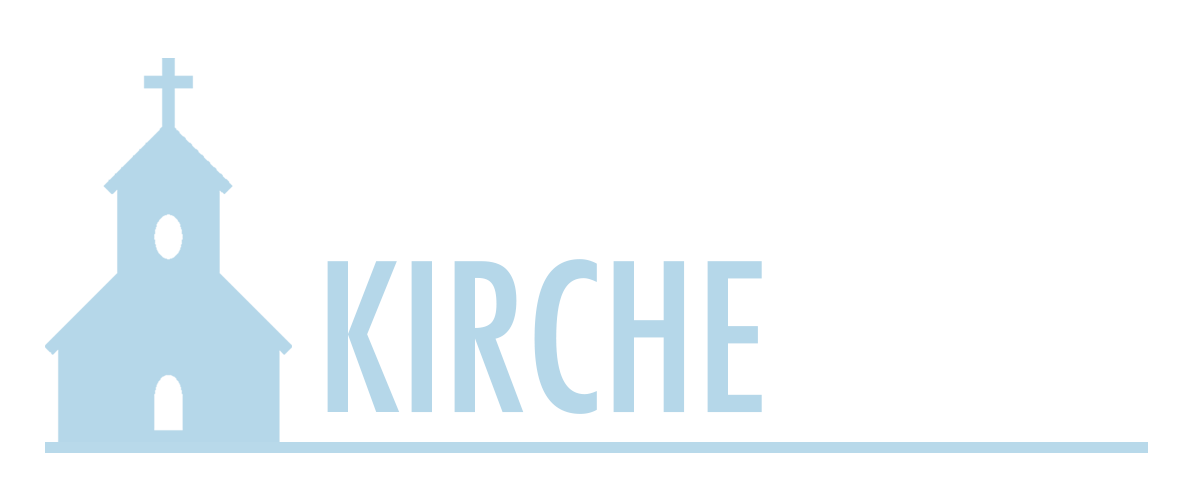Teil 3/3 der Serie: Künstliche Intelligenz: der digitalisierte Turmbau zu Babel
Die vorliegende Artikelserie hat uns auf eine Reise durch die komplexe Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) geführt. Eine Reise, die nun im dritten Teil zu ihrem praktischen Höhepunkt gelangt. Nachdem wir im ersten Teil die reduktionistische Weltanschauung der KI durchleuchteten und im zweiten Teil die dahinterliegende transhumanistische Ideologie des Homo Deus kritisch hinterfragten, wenden wir uns nun der entscheidenden Frage zu: Wie soll der Christ im Alltag mit dieser mächtigen Technologie umgehen? Dieser abschließende Artikel möchte zum einen zeigen, dass auch wir dem Reduktionismus der KI verfallen können und uns vor dem menschlichen Stolz der Allwissenheit, der sich im Homo Deus manifestiert, in Acht nehmen sollten. Er richtet sich an Gläubige, Familien und Gemeindeleiter, die vor der praktischen Herausforderung stehen, KI verantwortlich zu nutzen, ohne den subtilen Versuchungen zu erliegen, die mit ihr einhergehen. Die zentrale Zielsetzung besteht darin, eine biblisch fundierte Balance zwischen den unbestreitbaren Chancen und den ernsten Gefahren der KI zu finden – eine Balance, die weder naive Technikbegeisterung noch lähmende Technikangst kennt, sondern von geistlicher Weisheit und nüchterner Unterscheidung geprägt ist. Nur so können wir diese Technologie als Werkzeug zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst am Nächsten einsetzen, ohne unsere geistliche Integrität zu gefährden.
Das biblische Menschenbild als Fundament der Bewertung
Bevor wir uns den konkreten Chancen und Risiken der KI zuwenden, müssen wir das richtige Fundament legen. Jede Technologie ist moralisch ambivalent; ihre Auswirkungen hängen entscheidend vom Herzen und den Motiven des Benutzers ab. Die Heilige Schrift bietet uns hierfür den unverzichtbaren Schlüssel: ein realistisches und tiefes Verständnis der menschlichen Natur, das sowohl die Würde als auch das Böse des Menschen ernst nimmt. Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch als Krone der Schöpfung in Gottes Ebenbild geschaffen wurde (1Mos 1,27). Diese Gottebenbildlichkeit zeigt sich in unserer einzigartigen Fähigkeit zur Erkenntnis, zur ethischen Unterscheidung, zur Kreativität und zur Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. In diesem Licht können wir auch die Entwicklung von Technologien wie der KI als legitimen Ausdruck unseres gottgegebenen Auftrags verstehen, die Schöpfung zu gestalten und zu verwalten.
Die Folgen der Sünde
Gleichzeitig konfrontiert uns die Schrift mit der ernüchternden Realität des Sündenfalls. Der Mensch ist nicht mehr das, was er einmal war. In seinem Innersten wohnt eine tiefe Neigung zur Selbstsucht, zur Rebellion gegen Gott und vor allem zum Stolz – jener ursprünglichen Versuchung, „zu sein wie Gott“ (1Mos 3,5). Im unaufhaltsamen Drang nach Macht, Kontrolle und Selbstvergötterung offenbart sich die menschliche Selbstüberschätzung. Der Mensch spürt intuitiv, dass die künstliche Intelligenz, die er hervorbringt, seine eigenen moralischen Schwächen widerspiegelt. Diese Erkenntnis ist in unserem kulturellen Gedächtnis verankert – vom Frankenstein-Mythos bis zur Vorstellung einer die Welt beherrschenden KI. An genau diesem Punkt wird die geistige Relevanz der KI sichtbar: Sie macht den Menschen nicht ethisch besser, sondern verstärkt lediglich seine moralischen Konflikte. Diese tiefe Spannung zwischen menschlicher Kreativität einerseits und dem Missbrauch durch die gefallene Natur andererseits prägt jede menschliche Tätigkeit, besonders den Umgang mit mächtigen Technologien.
Der gefallene Mensch neigt dazu, die guten Gaben Gottes – sei es Intelligenz, Macht oder Wissen – nicht in demütigem Dienst am Nächsten einzusetzen, sondern zur eigennützigen Herrschaft über ihn zu missbrauchen (siehe z.B. Jak 4,1-3; Pred 7,29). Diese Tendenz zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte: Werkzeuge und Technologien, die ursprünglich dem Leben dienen sollten, wurden immer wieder auch zum Schaden eingesetzt. So brachte die Entdeckung des Metalls nicht nur Pflugscharen, sondern auch Schwerter hervor; die Beherrschung der Energie diente nicht nur zum Heizen von Häusern, sondern auch zur Entwicklung von Waffen; das Internet verbindet Menschen über Kontinente hinweg, ermöglicht aber ebenso Überwachung und unbeschränkte Pornografie. Die Verfügbarkeit scheinbar unbegrenzten Wissens durch KI kann den gefährlichen Eindruck erwecken, wir hätten die göttliche Perspektive erreicht (sogenannte Superintelligenz) und könnten nun unabhängig von Gott alle Fragen beantworten und alle Probleme lösen. Nur wenn wir diese innere Zerrissenheit des Menschen ernst nehmen – seine Würde als Ebenbild Gottes einerseits und seine Gefährdung durch die Sünde andererseits –, können wir die Chancen und Gefahren der KI angemessen beurteilen.
Die Chancen der KI: Ein Werkzeug zur Verherrlichung Gottes
Eine der wertvollsten Gaben der Künstlichen Intelligenz liegt erstens in ihrer Fähigkeit, das reiche Erbe reformierter Theologie – insbesondere der englischsprachigen Tradition – Gläubigen aller Bildungsstufen zugänglich zu machen. Die gewaltigen Werke unserer geistlichen Väter wie Calvins Institutio, die Schriften der Puritaner (Bunyan, Owen, Watson) oder die tiefgründigen Abhandlungen von Jonathan Edwards können durch KI-Systeme so aufbereitet werden, dass ihre zeitlose Wahrheit trotz komplexer Argumentation und historischer Sprachbarrieren erkennbar wird. Dies ersetzt niemals das persönliche Studium der Heiligen Schrift und der Bekenntnisschriften, sondern senkt die Hürden, damit auch junge Gläubige in die Lage versetzt werden, sich mit diesen geistlichen Schätzen zu befassen. Stellen wir uns einen jungen Christen vor, der von den Lehren der Reformation ergriffen ist, aber vor den lateinischen Begriffen und der dichten Argumentation der Reformatoren zurückschreckt. KI kann hier als treuer Diener fungieren: Sie übersetzt theologische Konzepte in klare Sprache, erklärt historische Zusammenhänge und macht die reformierte Bekenntnistradition greifbar – stets unter Wahrung der Lehreinheit.
Zweitens überwindet die KI die Sprachbarrieren, die bisher den Zugang zur englischsprachigen reformierten Literatur erschwerten. Die Werke von Spurgeon, Ryle, Lloyd-Jones oder zeitgenössischen treuen Lehrern – bisher oft nur englischsprachig verfügbar – können nun qualitätsgesichert übersetzt und mit den klassischen Bekenntnissen (Westminster, Belgisches, Heidelberger) verknüpft werden. Dies stärkt die reformierte Konfessionsgemeinschaft weltweit und bewahrt vor theologischer Verwässerung, indem es den Zugang zu den reinen Quellen der Schriftauslegung ermöglicht. Für Missionare und internationale Gemeindegründer eröffnen sich neue Möglichkeiten, solide theologische Materialien in verschiedenen Sprachen bereitzustellen. Die weltweite Verbreitung bewährter Lehrinhalte kann dazu beitragen, lokale Gemeinden vor Irrlehren zu schützen und eine einheitliche biblische Grundlage zu schaffen. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Globalisierung sowohl Chancen als auch Gefahren für die Reinheit der Lehre mit sich bringt.
Drittens eröffnen sich für christliche Familien neue Möglichkeiten der Glaubensvermittlung. Eltern können mit KI-Unterstützung lehrreiche Materialien erstellen, die genau auf das Verständnis ihrer Kinder zugeschnitten sind – etwa die Lehren des Westminster oder des Heidelberger Katechismus in altersgerechter Sprache oder die Geschichte der Reformation als spannende Erzählung. Tiefe Bibelkommentare können zu familientauglichen Andachten verarbeitet werden, die lehrmäßige Präzision mit einfacher Sprache verbinden. Dies entlastet Eltern in ihrer gottgegebenen Erziehungsaufgabe (Eph 6,4), ohne die elterliche Verantwortung abzugeben. Besonders Väter, die sich unsicher im theologischen Bereich fühlen, können durch KI-Unterstützung Vertrauen gewinnen, ihre Kinder im Glauben zu unterweisen. Die KI kann dabei helfen, schwierige Bibelstellen kindgerecht zu erklären, ohne die theologische Tiefe zu opfern oder in gefährliche Vereinfachungen zu verfallen.
Ein wertvoller Helfer
Für Hirten und Älteste der Gemeinde wird die KI zum wertvollen Helfer im Dienst am Wort. Sie kann als ‚Forschungsassistent‘ dienen, der schnell Auslegungstraditionen der Reformatoren und Puritaner vergleichbar macht, historische Kontexte beleuchtet und Schriftbezüge systematisch erschließt. Ein Pastor, der sich auf eine Predigt über ein schwieriges alttestamentliches Kapitel vorbereitet, kann mithilfe der KI effizient die Kommentare von Calvin, Henry oder Lenski konsultieren, ohne wertvolle Zeit für das eigentliche Gebet und die geistliche Durchdringung des Textes zu opfern. Die KI hilft auch dabei, zeitnahe Anwendungen zu finden, die der konkreten Situation der Gemeinde entsprechen – stets unter der Leitung des Heiligen Geistes und in Unterordnung unter die Schriftautorität. Darüber hinaus kann sie bei der Erstellung von Lehrplänen, der Vorbereitung von Bibelstunden und der seelsorgerlichen Beratung unterstützend wirken, ohne die persönliche Begegnung und das geistliche Urteilsvermögen zu ersetzen. In all diesen Bereichen erweist sich die KI als nützliches Werkzeug, das – weise und unter Wahrung der Schriftprinzipien eingesetzt – dazu beitragen kann, die reinen Lehren der Reformation zu bewahren, die Heiligung der Gläubigen zu fördern und das Reich Gottes in unserer Zeit zu bauen.
Die Gefahren der KI: Versuchung zur geistlichen Trägheit und zum Stolz
Der mühelose Zugang zu Wissen birgt Risiken: Während er Türen zu Erkenntnissen öffnet, verführt er zugleich zu geistiger Bequemlichkeit. Wenn Antworten nur einen Klick entfernt sind, droht die Gefahr, dass wir aufhören, selbst nachzudenken oder uns mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen – besonders im Glaubensleben. Unser Verstand ist wie ein Muskel: Er wächst durch Anstrengung und schwindet, wenn wir ihn vernachlässigen. Wenn wir mit einem Bibelvers ringen, über theologische Fragen nachdenken oder eigene Gedanken schmieden, übersteigt dies bei Weitem reine Verstandesarbeit. Solche Prozesse sind geistliche Schulung. Sie fordern uns heraus, geduldig zu sein, demütig zu bleiben und uns unserer Abhängigkeit von Gott bewusst zu werden. Denken wir an Jakob, der die ganze Nacht mit dem Engel rang (1Mos 32,22-32). Es war anstrengend, schmerzhaft, aber letztlich lebensverändernd.
Ähnlich ist es, wenn wir uns Zeit nehmen, über Gottes Wort nachzudenken. Der Prozess des Suchens und Fragens kann oft wertvoller sein als eine schnelle Antwort. In der reformatorischen Tradition ist das tiefe, betende Studium der Bibel zentral. Doch in einer Welt, in der KI in Sekunden Dutzende Auslegungen liefert, könnten wir die Geduld für diese stille, verändernde Begegnung mit Gott verlieren. Wenn KI uns jede Antwort auf dem Silbertablett präsentiert, riskieren wir, die Fähigkeit zum tiefen, eigenständigen Denken zu verlieren. Unser Glaube könnte zu einer Sammlung von Fakten werden, statt aus einem lebendigen, persönlichen Ringen mit Gott zu wachsen. Die Bibel warnt uns vor Trägheit – nicht nur körperlich, sondern auch geistlich (Spr 6,6-11). Ein Glaube, der auf vorgefertigten Antworten basiert, bleibt oberflächlich und wackelt bei der ersten Herausforderung. Wahre geistliche Reife entsteht durch das geduldige Prüfen, Abwägen und die Bereitschaft, unsere Grenzen vor Gott einzugestehen. Es ist wie ein Hausbau: Ohne ein starkes Fundament, das durch Anstrengung und Hingabe entsteht, wird der Glaube im Sturm nicht standhalten.
Eine Frage der Weisheit
Natürlich kann KI ein großartiges Werkzeug sein. Sie macht Wissen zugänglich und kann uns unterstützen. Doch die Kunst besteht darin, sie weise zu nutzen, ohne die eigene Anstrengung aufzugeben. Die Bibel fordert uns auf: Prüft alles, und das Gute behaltet (1Thess 5,21). KI kann ein Diener sein, der uns hilft, Gottes Wahrheit zu suchen, aber sie darf nicht die geistliche Disziplin ersetzen, die uns näher zu Ihm bringt. Wahre Weisheit kommt durch Geduld, Gebet und das Nachsinnen über Gottes Wort (Jak 1,5). Selbst wenn wir KI mit Bedacht nutzen, bleibt die Versuchung des Stolzes. Die vielleicht subtilste und gefährlichste Versuchung der KI liegt in ihrer Fähigkeit, unseren angeborenen Stolz zu nähren. Der schnelle und scheinbar umfassende Zugang zu Informationen kann die trügerische Illusion erzeugen, alles zu wissen und zu verstehen. Diese gefühlte Allwissenheit ist eine raffinierte, moderne Variante der ursprünglichen Versuchung, sich über die gottgegebenen Grenzen zu erheben und die eigene Vernunft zu vergöttern (1Mos 3,4-6, Jes 14,13-14).
Ein Christ, der sich daran gewöhnt, jede Frage sofort von einer KI beantwortet zu bekommen, läuft Gefahr, jene Demut zu verlieren, die für echten Glauben so fundamental ist. Er fängt an, sich auf sein eigenes vermeintliches Wissen zu stützen und übersieht dabei, wie wichtig es ist, auf Gott zu vertrauen, im Gebet zu bleiben und die Wahrheit Schritt für Schritt durch das Studium der Heiligen Schrift zu erarbeiten. Diese Versuchung ist besonders heimtückisch, weil sie sich in scheinbar geistlichen Gewändern präsentiert. Der Benutzer mag denken, er diene Gott, indem er sein Wissen über theologische Fragen erweitert. Doch unmerklich verlagert sich der Fokus von der lebendigen Begegnung mit Gott hin zur sterilen Ansammlung von Informationen über Gott. Das Resultat ist eine Form geistlicher Gehörlosigkeit: Die leise Stimme des Heiligen Geistes wird vom lauten Rauschen der Daten übertönt. Anstatt in der Stille vor Gott zu warten und auf seine Führung zu lauschen, verlassen wir uns auf die sofortige Verfügbarkeit maschinell generierter Antworten. Psalm 46,11 ermahnt uns: Seid still und erkennet, dass ich Gott bin! – eine Ermahnung, die in der Ära sofortiger Antworten besondere Relevanz erhält.
Soziale Entfremdung und die Erosion der Gemeinschaft
Diese individuelle Versuchung hat schwerwiegende Konsequenzen für die Gemeinschaft der Kirche. Die gottgegebene Autorität des Predigtamtes wird untergraben, wenn die Predigt des Pastors nicht mehr als Auslegung eines berufenen Dieners Gottes aufgenommen wird, sondern als eine Meinung unter vielen, die man mit einem Klick gegen dutzende KI-generierte Interpretationen ausspielen kann. Die verkündigte Wahrheit wird zur Verhandlungssache, und die Autorität des Wortes Gottes geht im Lärm konkurrierender Stimmen unter. Diese Entwicklung fördert eine individualistische Haltung, bei der jeder sein eigener Theologe wird. Die biblische Vision der Gemeinde als Leib Christi (1Kor 12), in dem jedes Glied auf das andere angewiesen ist, wird durch einen autonomen Individualismus ersetzt. Die Gemeinschaft der Heiligen, der gegenseitige Austausch, die liebevolle Ermahnung und die Unterordnung unter die Lehrautorität der Kirche werden als unnötige Einschränkungen empfunden – ein direkter Widerspruch zum biblischen Gemeindeverständnis.
Glaube und geistliches Wachstum sind in der biblischen Tradition zutiefst gemeinschaftliche Prozesse. Wir sind aufgerufen, einander zu lehren und zu ermahnen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern (Kol 3,16). Wenn Antworten nur noch einen Mausklick entfernt sind, schwindet die Notwendigkeit und die Bereitschaft zum Dialog. Warum noch in der Bibelstunde über eine schwierige Stelle diskutieren, wenn die KI eine fertige Antwort liefert? Warum noch das Gespräch mit dem weisen älteren Bruder im Glauben suchen, wenn die Maschine schneller und scheinbar umfassender antwortet? Diese Entwicklung schwächt die lebendige Gemeinschaft und ersetzt sie durch eine sterile Interaktion mit einer Maschine, die weder echte Beziehung noch Liebe noch geistliche Verantwortung kennt. Der reichhaltige Austausch unterschiedlicher Perspektiven, das geduldige Zuhören, das liebevolle Korrigieren und das gemeinsame Ringen um die Wahrheit werden durch den einsamen Dialog mit der KI ersetzt. Dabei geht nicht nur die Wärme menschlicher Beziehung verloren, sondern auch die korrigierende und schärfende Wirkung der Gemeinschaft (Spr 27,17: Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mann das Angesicht seines Nächsten).
Der Verlust des gegenseitigen Zuhörens
Die Isolation durch KI-Abhängigkeit zeigt sich auch in der Evangelisation. Das persönliche Zeugnis von der verändernden Kraft des Evangeliums kann durch rationale Debatten ersetzt werden, in denen der Nicht-Gläubige jede Aussage mit KI-generierten Gegenargumenten kontert. Der Fokus verschiebt sich vom Wirken des Heiligen Geistes und der authentischen Ausstrahlung eines veränderten Lebens hin zu einem sterilen Informationsaustausch. Wahre Evangelisation geschieht primär nicht durch schlagkräftige Argumente, sondern durch die überzeugende Kraft des Heiligen Geistes und durch ein geheiligtes Leben. Wenn ein Christ jedoch gewohnt ist, alle geistlichen Herausforderungen an eine KI zu delegieren, verliert er möglicherweise die Fähigkeit, authentisch und persönlich von seinem Glauben zu zeugen. Seine Antworten werden zu kopierten Textbausteinen anstatt zu echten, aus dem Herzen kommenden Bekenntnissen der Gnade Gottes in seinem Leben.
Ein weiteres Risiko liegt in der ideologischen Fragmentierung (Aufsplitterung). KI-Systeme basieren auf ihren Trainingsdaten und können unbemerkt theologische Schieflagen oder liberale Ideologien verbreiten. Sie schaffen sogenannte Echokammern, in denen Nutzer nur noch mit Meinungen konfrontiert werden, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen. Ein konservativer Christ mag Antworten erhalten, die von liberalen theologischen Strömungen geprägt sind, ohne dies zu erkennen. Umgekehrt können bestehende liberale Vorurteile verstärkt werden, indem die KI selektiv diesen Kreisen nur bestätigende Informationen liefert. Diese Entwicklung kann die bereits bestehenden Spaltungen innerhalb der Christenheit weiter vertiefen und den Blick für die universale Wahrheit des Evangeliums verengen. Anstatt die Umkehr und die Einheit in der Wahrheit zu fördern, die Paulus in 1. Korinther 12 beschreibt, können KI-generierte Echokammern zu einer weiteren Fragmentierung der christlichen Gemeinschaft und der Verhärtung der Herzen von Menschen beitragen.
Fazit: KI als Spiegel und Prüfung menschlicher Weisheit
Die Erkundung der Künstlichen Intelligenz enthüllt ihre paradoxe Natur mit unerbittlicher Klarheit: Sie ist zugleich Tor zur Erkenntnis und Abgrund der Verführung. Ihre fundamentale Struktur – basierend auf notwendiger Abstraktion und Reduktion komplexer Realität – macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für den Wissenszugang, doch niemals zur Quelle vollständiger Wahrheit. Wer ihre methodischen Grenzen missachtet, verfällt dem gefährlichen Irrtum, dass fragmentierte Daten den Reichtum der Schöpfungswirklichkeit ersetzen könnten. Diese Erkenntnis ist besonders im christlichen Kontext von entscheidender Bedeutung: Die bewusste Anerkennung der KI-Beschränkungen verhindert eine Überbewertung ihrer Aussagen und bewahrt uns davor, algorithmisch produzierte Berechnungen mit der Tiefe göttlicher Offenbarung zu verwechseln. Die tiefste Brisanz liegt jedoch nicht im Algorithmus selbst, sondern im menschlichen Herzen. Die Leichtigkeit des Wissenserwerbs nährt den uralten Stolz – vom Homo-Deus-Wahn des Ungläubigen bis zur subtilen Selbstüberhebung des Gläubigen –, der meint, durch Technologie geistliche Reife abkürzen zu können.
Gleichzeitig lockt die KI zur geistlichen Trägheit: Sie suggeriert mühelose Einsicht, wo doch wahre Weisheit im disziplinierten Ringen mit Gottes Wort, im demütigen Nachdenken über theologische Tiefen und im schmerzhaften Formulieren eigener Gedanken vor dem Angesicht Gottes reift. Hier zeigt sich die geistliche Disziplin im Kern: Sie widersteht der Verführung, intellektuelle oder technische Erschließung mit geistlicher Durchdringung zu verwechseln. Es gibt und kann keine standardisierte Kochrezeptformel für einen ‚richtigen‘ Umgang geben. Nur eine in der Heiligen Schrift fest verwurzelte Lehre vom Menschen – die uns als Ebenbild Gottes mit unantastbarer Würde ausstattet und zugleich als gefallene Geschöpfe mit verführerischer Anfälligkeit für Sünde und Selbstvergötterung warnt – schützt wirksam vor transhumanistischen Illusionen. Sie lehrt uns, die KI als begrenztes Werkzeug zu gebrauchen: für die Verbreitung des Evangeliums in digitalen Räumen, für den Gemeindebau durch theologische Reflexion, ja – doch stets mit wachsamem Herzen, das die Versuchung zur Selbstvergötterung erkennt und ihr widersteht.
Ein wichtiger Prüfstein
Die KI wird so zum Prüfstein unserer Unterscheidungskraft: Dienen wir dem Schöpfer mit Seinen Gaben – oder erheben wir uns selbst zum Herrn über Seine Schöpfung? Die Gemeinde Christi ist aufgerufen, weder in technologische Euphorie zu verfallen noch in dämonisierender Angst zu verharren. Stattdessen braucht es nüchterne, spirituell gereifte Weisheit: die Chancen für das Reich Gottes mutig zu ergreifen, und dabei die uralte Versuchung zur Selbstverherrlichung nicht zu unterschätzen. Dies bedeutet konkret, KI als Dienerin des Evangeliums einzusetzen – für Übersetzungsdienste, für die Erschließung theologischer Schätze, für die Verbindung Gläubiger über Grenzen hinweg – während wir gleichzeitig unsere Herzen mit ehrfürchtiger Gottesfurcht bewachen. Die KI ist kein neutrales Instrument, sondern ein Spiegel unserer Herzenshaltung: Sie offenbart, ob wir in Demut wandeln oder im Stolz straucheln.
So bleibt die uralte Wahrheit in der digitalen Revolution aktueller denn je: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit (Ps 111,10; Spr 9,10). In dieser demütigen Anerkennung von Gottes Souveränität und unserer radikalen Geschöpflichkeit liegt der unverrückbare Kompass für das digitale Zeitalter – nicht in der Flucht vor der Technik, sondern im mutigen, besonnenen Zeugnis: Dass allein der dreieinige Gott Quelle allen Lebens, aller Wahrheit und aller wahren Intelligenz ist. Gestützt auf diese Gewissheit wollen wir die unvorhergesehenen Weichenstellungen und Chancen der KI-Ära bewältigen: mit der Weisheit der Seraphim, die uns in Demut vor Gottes Unbegreiflichkeit bewahrt (Jes 6,1-3); mit der Demut des Nazareners, der uns Christi Vorbild vor Augen stellt (Phil 2,5-8); und mit der Hoffnung auf Christi Wiederkunft, die unseren Blick fest auf das ewige Ziel richtet (Tit 2,13).
Didier Erne arbeitet als Berater in der Finanzwelt und hat an der Universität Genf Wirtschaftswissenschaften und an der Faculté Jean-Calvin in Aix-en-Provence reformierte Theologie studiert. Mit seiner Frau Michelle und seinen drei Kindern gehört er der Presbyterianischen Gemeinde Zürich an.