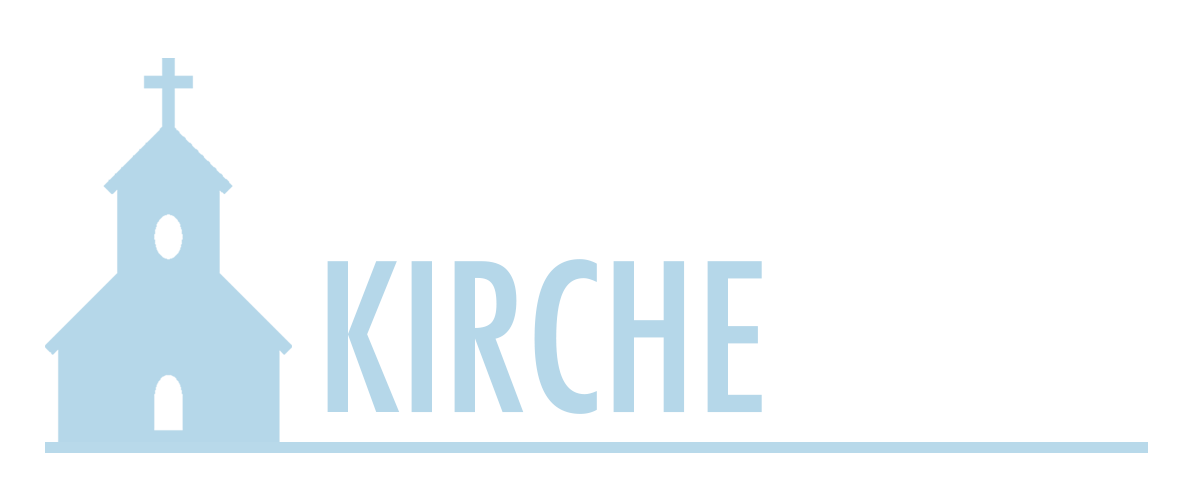Ihr sollt heilig sein; denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig.
(3.Mose 19,2)
Gyula Bagoly[1]
Heiligkeit ist etwas, das wir anstreben sollten und was Gott von uns verlangt. Dennoch gibt es etwas in uns, das uns zögern lässt, die Idee der Heiligkeit wirklich zu lieben. Unter vielen Gründen möchte ich mit diesem einen beginnen: Es gibt viele Missverständnisse über die Heiligkeit Gottes.
Der Schweizer Theologe Karl Barth (1886-1968) und einige andere Liberale[2] verwendeten den Begriff ‚der ganz Andere‘, um Gott zu beschreiben und seine Transzendenz und Heiligkeit zu betonen. So sagte Barth: „Wenn wir Christen von Gott sprechen, müssen wir uns bewusst sein, dass dieses Wort von Anfang an ,der ganz Andere‘ bedeutet… der Gott des christlichen Glaubens ist anders als alle anderen Götter. Er ist nicht erfunden, und er ist nicht zu finden, er ist nicht der Gott, den der Mensch am Ende entdeckt… Nach dem christlichen Bekenntnis ist Gott ganz anders in seiner Existenz.“[3]
Der ganz Andere?
Barth übernahm diese Idee des ‚ganz Anderen‘ von Rudolf Otto (1869-1937), einem deutschen Theologen, der ein Buch mit dem Titel Die Idee des Heiligen schrieb. Otto prägte nicht nur den Ausdruck ‚der ganz Andere‘, sondern auch das Wort ‚numinos‘ für die Beschreibung der Heiligkeit Gottes. Er sagte: „Heiligkeit ist eine Kategorie der Interpretation … sie enthält ein spezifisches Element oder ,Moment‘, das sie vom ,Rationalen‘ unterscheidet“[4] . Dieses rationale Element war für Otto die alte Interpretation des Heiligen im Sinne von „vollkommen gut … einfach der vollkommen moralische Wille“.[5] Stattdessen sagte er, wir sollten diese moralische und rationale Haltung aufgeben und das Heilige als das Numinose begreifen, das „ein absolut primäres und elementares Element … ist, das nicht streng definiert werden kann.“[6] Dies sei ein Gefühl des Schreckens oder der Angst angesichts des Heiligen, das er als ‚mysterium tremendum‘ (schauervolles Geheimnis) bezeichnet. Wir könnten also nichts über die Heiligkeit Gottes sagen, wenn wir nur dieses zitternde Gefühl der Ehrfurcht vor dem ‚ganz Anderen‘ oder dem Numinosen erlebten.
Da alle heiligen Menschen in der Bibel, die mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurden, dieses Zittern beim Anblick des heiligen Gottes erlebten, scheint dies ein stichhaltiges Argument zu sein. Aber Otto ging noch weiter und sagte, dass diese Erfahrung auch bei niederen geistigen Wesen (wenn auch in geringerem Ausmaß) wie Dämonen zu beobachten sei. Für ihn gilt: „,Dämon‘ im allgemeineren Sinne des Wortes ist der, wenn er selbst noch kein ,Gott‘ ist, noch weniger ein Anti-Gott, sondern als ,Vor-Gott‘ bezeichnet werden muss, das Numen auf einer niedrigeren Stufe… aus der der ,Gott‘ allmählich zu immer erhabeneren Erscheinungsformen heranwächst.“[7] Einige Liberale gingen sogar so weit, dass sie einige der Erscheinungsformen Jahwes im Alten Testament als dämonisch ansahen – vor allem, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Zorn und den Strafen Gottes anfangen sollten.
Heiligkeit überall?
Kein Wunder, dass der rumänische Religionsphilosoph Mircea Eliade (1907-1986) Ottos Ideen aufgriff und ein Buch mit dem Titel Das Heilige und das Profane schrieb, in dem er zeigt, wie diese Heiligkeit in allen Weltreligionen zu finden sei. Er fährt fort zu erklären, wie das Numinose sowohl in heiligen Orten als auch in Ereignissen gesehen werden könne.
Aber wenn das so wäre – warum gibt es dann im Alten Testament all die Verbote in Bezug auf Götzendienst und die Anbetung falscher Götter? Warum übt unser heiliger Gott seinen heiligen Zorn sogar gegen sein Volk aus, das falsche Götter anbetete? Interessanterweise gehen weder Rudolf Otto noch Mircea Eliade bei ihrer Suche nach dem Numinosen im Alten Testament auf die Probleme des Götzendienstes ein.
Heilig = unerreichbar?
Meine erste Begegnung mit der Vorstellung, dass Gott ein ‚ganz anderer‘ ist, war nach meiner Bekehrung im Alter von etwa 18 Jahren, als ich mit einem ungarischen reformierten Pfarrer sprach, der mir sagte, dass wir einfach nicht frei zu diesem Gott beten sollten, da er so weit von uns entfernt sei, so transzendent, dass wir ohnehin nicht viel über ihn wissen könnten. Ich war damals schockiert, das zu hören. Aber schließlich verstand ich, dass für die Liberalen ein persönlicher Gott, der sich uns in Christus offenbart und durch seinen Geist in uns lebt, nicht viel Sinn ergibt.
Tatsächlich überrascht war ich allerdings, dass selbst unter evangelikalen Christen die Rede von einem heiligen Gott oft ausschließlich bedeutet, dass er von uns getrennt, abgesondert, völlig anders, rein und vollkommen ist. Und wenn wir über seine Heiligkeit nachdenken, wird dies dann oft zu etwas, das wir nur fürchten, statt zu etwas, das wir uns für uns selbst wünschen.
Heiligkeit als etwas Abstoßendes?
Als ich 6 bis 7 Jahre alt war, nahmen meine Eltern mich zum Schwimmunterricht mit. Leider hatte der Lehrer nicht viel Zeit, um uns zu unterrichten. Also stellte er alle Kinder in der Nähe des Beckens mit tiefem Wasser auf und forderte uns auf, hineinzuspringen. Das taten wir dann auch und ich wäre fast ertrunken. Der Lehrer hatte einen langen Stock, und wenn jemand in der Gefahr stand zu ertrinken, zog er das arme Kind einfach mit dem Stock zur Seite und wiederholte die Übung.
Ich gehörte zu denjenigen, die fast gestorben sind. Zumindest fühlte es sich für mich so an. Von da an reichten weder der elterliche Zwang noch irgendwelche netten Worte aus, um mich wieder ins Schwimmbad zu bringen. Meine Eltern gaben auf und ich wäre ein Leben lang mit diesem Trauma und mit meiner Vorstellung zurückgeblieben, dass Wasser etwas ist, das man meiden muss. Aber als ich etwa 15 Jahre alt war, ging ich mit meinen Eltern zu einem Thermalsee, und dort entdeckte ich, dass ich Wasser wirklich mag. Innerhalb einer Woche lernte ich schwimmen.
Ich erzähle diese Geschichte, um zu verdeutlichen, dass für einige Menschen Gottes Heiligkeit so ist, wie das Wasser lange für mich war. Sie hören von anderen, die Gottes Heiligkeit genießen, aber für sie selbst ist dieser Ozean immer noch etwas Schreckliches, das sie besser meiden sollten.
In meinem Bemühen, den Begriff der Heiligkeit besser zu verstehen, habe ich Wertvolles bei dem deutsch-niederländischen reformierten Theologen Petrus van Mastricht (1630-1706) gefunden, so dass ich mich in einigen meiner Argumente auf sein Werk Theologia Practica stützen werde.
I. Exegetische Argumente dafür, warum der heilige Gott mehr ist als der „ganz Andere“
Wenn wir verstehen wollen, warum Gott in seiner Heiligkeit mehr ist als der vage ‚ganz Andere‘, finden wir eine hilfreiche Erklärung bei Mastricht: „Damit wir leichter verstehen, was die Heiligkeit Gottes ist, die uns erst einmal unzugänglich ist, da sie in ihm existiert, ist es notwendig, dass wir diese Heiligkeit in ihrem Bild betrachten, das heißt, in der abgebildeten Heiligkeit der Geschöpfe. Deshalb ist die Heiligkeit zunächst nichts anderes als die ‚moralische Güte eines vernünftigen Wesens‘.“[8] Mastricht führt uns also auf diese Idee der moralischen Güte zurück, um etwas über die Heiligkeit sagen zu können, da wir sonst darüber schweigen müssten.
1. Die Bedeutung des Wortes heilig (hebräisch kadosh, griechisch hagios)
Mastricht beginnt mit Beispielen von Heiligkeit bei Menschen in der Bibel und stellt vier Kategorien auf, in denen das Wort heilig verwendet wird.
a. Abtrennung zu einem bestimmten Zweck – abgesondert
Wir lesen von Paulus, der für das Amt eines Apostels ausgesondert wurde (Röm 1,1; Gal 1,15). Auch können wir dies bei Gott sehen oder wir lesen es über Jesus, der heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern ist (Hebr 7,26) und den der Vater geheiligt, also zu einem bestimmten Zweck abgesondert hat (Joh 10,36). In diesem Sinne ist Gott von uns abgesondert, und in diesem Sinne ist er wirklich anders als wir, denn er ist unser Schöpfer und wir sind seine Schöpfung.
b. Abscheu vor dem Bösen
Zweitens bedeutet heilig, das zu verabscheuen, was Böse ist, es für einen Gräuel zu halten, zu hassen und abzulehnen. Das Volk Gottes musste Götzen verabscheuen und für ein Gräuel halten und durfte sie nicht in seine Häuser bringen (5.Mose 7,26). Denn Gott ist ein Gott, der alles Böse verabscheut. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt; wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen; du hasst alle Übeltäter (Ps 5,5.6).
c. Hingabe an Gott
Das heilige Leben beginnt mit der Hingabe an Gott. Dazu ruft uns Paulus in Röm 12,1 auf: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst! Und Gott tut dasselbe, da er sich selbst und seiner Herrlichkeit verpflichtet ist. Alles hat der HERR zu seinem bestimmten Zweck gemacht (Spr 16,4).
d. Das Sichtbarwerden moralischer Vortrefflichkeit
Heiligkeit ist auch die Offenbarung der Reinheit des göttlichen Gesetzes, des Charakters Gottes, wie wir ihn in unserem Herzen wahrnehmen und wie er sich nach außen hin zeigt. Darum betet der Psalmist: Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz, und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern! (Ps 51,12)
Diese moralische Vortrefflichkeit, die sich in Gottes Gesetz zeigt, ist die Vortrefflichkeit, die Gott selbst liebt, verteidigt und aufrechterhält. Diese Vortrefflichkeit in jedem Aspekt des Gesetzes ist es, was Jesus fordert, wenn er sagt: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist! (Mt 5,48) Denn es gibt nichts Gutes außer Gott.
2. Gott selbst ist die Heiligkeit als Maßstab der moralischen Güte und Vortrefflichkeit – nicht nur der „ganz Andere“
Wie bereits erwähnt, können wir sehen, dass Heiligkeit die Trennung vom Bösen ist, der Hass auf das, was abstoßend ist. Aber Heiligkeit ist auch eine Liebe und ein Eifer für alles, was gut und moralisch ausgezeichnet ist. Vor einigen Jahren gab es in Ungarn eine Wohltätigkeitskampagne mit dem Titel: „Gut zu sein ist gut“. Ich würde das so ausdrücken: „Heilig zu sein ist gut.“ Heiligkeit bedeutet in den Worten Mastrichts, „eine absolute Güte, durch die Gott mit aller moralischen Reinheit verbunden ist und alle Unreinheit der Sünde verabscheut.“[9]
Wenn man Heiligkeit reduziert auf einen Gott, der ‚ganz anders‘ ist, findet man alle möglichen seltsamen Verhaltensweisen, die als heilig eingestuft werden. Ich weiß, dass in allen Kulturen der heilige Mensch, die heiligen Rituale ganz anders sind, als die weltlichen und profanen Verhaltensweisen. Aber das macht Götzendienst noch lange nicht zu einer heiligen Handlung.
In Russland gab es eine Sekte von Mönchen, die „verrückte Mönche“ genannt wurden (Chlyst-Sekte). Viele Menschen haben es damals nicht gewagt, das Verhalten der Mitglieder in Frage zu stellen, da sie ja angeblich ‚heilige Männer‘ waren, die Wunder vollbrachten. Nun ist unser Gott ein heiliger Gott, aber seine Andersartigkeit ist untrennbar mit moralischer Reinheit verbunden. Er ist nicht nur anders als wir, sondern auch moralisch hervorragend, vollkommen und tadellos.
3. Heiligkeit ist ein Gebot des Bundes
Heiligkeit kann nur im Sinne des Bundes verstanden werden. Du sollst heilig sein, denn ich, der HERR, dein Gott, bin heilig. Gott hat sich uns gegenüber verpflichtet. Er hat uns durch sein Opfer am Kreuz von unseren Sünden erlöst. Und er ist der Gott, der für uns ist. Sein Bund der Gnade verpflichtet uns, heilig zu sein. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen (Eph 2,8–10).
II. Heiligkeit ist die Vortrefflichkeit der Güte Gottes in allen seinen Eigenschaften
Mastricht schreibt über Gottes Güte: „Wenn sie absolut als wünschenswert betrachtet wird, … wird sie ausdrücklich Gottes Güte genannt. Wenn sie als Mitteilung von etwas Gutem betrachtet wird, … wird sie als Liebe, Gnade und Barmherzigkeit bezeichnet. Wird sie als Handeln nach einer bestimmten Regel betrachtet, wird sie Gerechtigkeit genannt. Wird sie schließlich als Regel des Handelns betrachtet, die den vernunftbegabten Geschöpfen vorgeschrieben ist, so wird sie als Heiligkeit bezeichnet.“[10] Nach Mastricht wird also Gottes moralische Güte, „durch die er in besonderer Weise nachahmbar ist, … Heiligkeit genannt.“[11]
Diese moralische Güte ist mit allen Eigenschaften Gottes verbunden. Er ist heilig in allen seinen Personen. Er ist heilig, weil er gerecht und rechtschaffen ist. Er ist ein heiliger, liebender Gott, ein gnädiger und barmherziger Gott.
1. Die heilige Dreieinheit Gottes
Die Bibel spricht davon, dass Gott der Heilige schlechthin ist. Er wird der Heilige Israels genannt. (Jes 40,25; Hab 3,3). Der Vater ist heilig (Joh 17,11), der Sohn ist heilig (Dan 9,24) und der Heilige Geist ist heilig (Röm 1,4). Kein Wunder, dass unser Gott der Heilige ist. Als Jesaja die Engel ausrufen hörte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, unser Gott, erkannte er den dreimal heiligen Gott. Er ist in seiner Heiligkeit vollkommen – er ist aber auch der dreieine Gott.
2. Gottes heilige Gerechtigkeit
Natürlich ist Gottes heilige Gerechtigkeit, die sich uns offenbart, ehrfurchtgebietend, schrecklich und lässt uns erzittern. Aber selbst sein gerechter Zorn dient dazu, Gottes moralische Güte zu verteidigen. Aufgrund seiner regierenden Gerechtigkeit lenkt er alles in Übereinstimmung mit seinem Wesen; er hat eine richterliche Gerechtigkeit, mit der er die ganze Erde als gerechter Richter richtet; er hat eine gesetzgebende Gerechtigkeit, mit der er uns Gesetze gibt; er hat eine züchtigende Gerechtigkeit, mit der er seine Kinder korrigiert, und er hat eine rächende Gerechtigkeit, aufgrund derer jede Sünde ihre Strafe bekommt.[12]
Jesaja war zu seiner Zeit einer der aufrichtigsten Männer in Israel. Aber selbst er empfand, dass er es wert ist, verurteilt zu werden, da er unreine Lippen hatte (Jes 6,5). Wenn sich Gottes Heiligkeit offenbart, ist es kein Wunder, dass man diese Gerechtigkeit spürt. In manchen Fällen sind Menschen sogar gestorben: die Söhne Aarons, als sie fremdes Feuer darbrachten (3Mos 10,1.2) oder Ussa, als er die Bundeslade berührte und dachte, seine Hände seien sauberer als der Schmutz der Erde (2Sam 6,6.7).
Aber selbst diese heilige Gerechtigkeit ist für uns kostbar, weil sie uns zum Kreuz unseres Erlösers führt. Dort können wir sehen, dass alle unsere Sünden in Jesus Christus bestraft wurden. Diese Gerechtigkeit überführt uns, indem sie uns zeigt, dass wir Genugtuung brauchen. Deshalb staunen wir über das Kreuz unseres Erlösers, an dem all unsere Sünden die gerechte Strafe erhielten und uns die Heiligkeit Christi zu unserer Rechtfertigung geschenkt wurde.
3. Gottes heilige Liebe
Die Frage ist nicht nur, warum Gott in seiner heiligen Gerechtigkeit straft, sondern auch warum er so langmütig ist mit all den Sünden dieser Welt. Wie viele Milliarden Sünden werden jeden Tag begangen, ohne das Gott sie direkt bestraft? Es ist derselbe heilige Gott, der sagt: Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim, wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt! Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben; denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen (Hos 11,8.9). Das ist der heilige Gott, der seinen Zorn zügelt und seinem Volk seine Barmherzigkeit zeigt.
Als Jesaja den heiligen Gott sah, fiel er einfach zu Boden und sagte: Wehe mir, ich habe unreine Lippen. Er hatte gerade erfahren, dass alles, was er sagte, angesichts des heiligen Gottes schmutzig war. Dann kam ein Engel, nahm eine brennende Kohle vom Altar und reinigte Jesajas Lippen. Diese heilige Liebe ist wie ein brennendes Feuer, das allen Schmutz und alle Sünde verzehrt. Es ist die Heiligkeit eines vollkommenen Opfers.
Diese heilige Liebe sehen wir in Christus, in dem wir seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit begegnen. In Jesus sehen wir die Schönheit der Heiligkeit. In Jesus sehen wir die Heiligkeit, die mit Maria am Grab des Lazarus weint – in Jesus sehen wir die Heiligkeit, die die Aussätzigen berührt – in Jesus sehen wir die Heiligkeit, die die Armen speist und heilt, und in Jesus sehen wir die liebende Heiligkeit am Kreuz für unsere Erlösung. In Jesus sehen wir das heilige Lamm Gottes.
III. Wie Gottes Güte uns heiligt
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung… denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung (1Thess 4,3.7).
Gott ist nicht nur der Gott, der sich selbst in seiner Heiligkeit groß macht, sondern auch der Gott, der in Jesus in seiner Heiligkeit auf diese Erde kam und uns Tag für Tag erduldet: Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? (Mt 17,17). Er hat uns geheilt und für unsere Sünden gesühnt. Er ist von den Toten auferstanden, in den Himmel aufgefahren und hat seinen Heiligen Geist in unser Herz gesandt, um uns durch ihn zu heiligen.
1. Gott heiligt uns, indem wir die Heiligkeit bewundern und ihn dafür preisen
Es sollte unsere Priorität sein, täglich zu Gott zu schreien und zu bitten: Schaffe in mir ein reines Herz, oh Herr. Denn selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen (Mt 5,8). Es ist vergeblich, nur etwas über Gott zu lernen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wer er ist, und dabei über die Schönheit seiner Heiligkeit nachdenken: O Gott, du bist mein Gott; früh suche ich dich! Meine Seele dürstet nach dir; mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben; meine Lippen sollen dich rühmen (Ps 63,2–4).
Alle unsere Diskussionen, unser Bibellesen, die Predigten sowie Taufe und Abendmahl sollen auf unseren Herrn Jesus hinweisen. Lasst uns nicht nur erkennen, dass er ganz anders war als wir, sondern seine Heiligkeit, seine Vortrefflichkeit in seiner Gerechtigkeit, Liebe und Gnade sollen unsere Herzen wie ein Magnet zu ihm hinziehen, damit wir wirklich staunend sagen können: Es gibt keinen Guten außer einem, nämlich Gott (Mt 19,17).
2. Gott heiligt uns, indem wir seinen Namen heiligen
Die erste Bitte im Unser Vater lautet: Geheiligt werde dein Name. Wenn Heiligkeit für unser Leben wichtig ist, müssen wir uns als Erstes damit befassen, wie wir den Namen unseres Herrn heiligen können. Der Große Westminster Katechismus erinnert uns daran. In Frage 112 heißt es: „Was wird im dritten Gebot gefordert?“ Antwort:
„Das dritte Gebot verlangt, dass der Name Gottes, seine Titel, Eigenschaften, Ordnungen, das Wort, die Sakramente, das Gebet, Eide, Gelübde, Lose, seine Werke und alles, wodurch er sich sonst zu erkennen gibt, heilig und ehrfurchtsvoll in Gedanken, Nachdenken, Wort und Schrift gebraucht werden, durch ein heiliges Bekenntnis und ein verantwortliches Verhalten, zur Ehre Gottes und zum Wohl von uns und anderen.“
Wir müssen in unserem täglichen Leben zeigen, dass Gottes Name nicht nur wichtig für uns ist, sondern dass er uns heilig ist. Wir dürfen nicht dulden, dass er verspottet und als Schimpfwort benutzt wird. Unser Gott ist ein gerechter und barmherziger Gott, und seine Güte zeigt sich in allem, was er tut. Wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir nicht nur von einem Konzept oder einer mystischen Erfahrung, sondern von unserem Herrn Jesus, dessen Name über allen Namen steht.
3. Gott heiligt uns, indem wir ihn zum Zentrum des Gottesdienstes machen
Unser heiligender Gott möchte, dass wir für einen Gottesdienst kämpfen, der heilig ist. Wir sollen erkennen, dass ein heiliger Gott nicht angebetet werden kann, wenn der Gottesdienst vernachlässigt wird. In unseren Ländern sind Gottesdienste oft auf das Niveau von Unterhaltungsprogrammen gesunken. Vielerorts geht es in den Gottesdiensten vor allem um uns, um unsere Gefühle und um einen Pastor, der mehr Unterhalter als Verkündiger ist. Sogar in vielen reformierten Kirchen scheint der Gottesdienst nicht mehr zu sein als das Abspulen eines Programms und das Anhören einer Predigt.
Wir sollten wieder betonen, dass wir im Gottesdienst in die heilige Gegenwart Gottes kommen, dass wir durch seine Güte und Gnade am Gottesdienst der Engel und der Heiligen teilhaben. Johannes Calvin hat es in einem seiner Gebete so gesagt:
„Herr Gott, unser ewiger und allmächtiger Vater! Wir sind hier versammelt und bringen in Gemeinschaft der Heiligen, der Engel und der verstorbenen Geister unser Opfer vor deinem Thron dar. Wir erklären und bekennen vor deiner heiligen Majestät, dass wir arme Sünder sind, in Sünde empfangen, willig, alles Böse zu tun und unablässig deine heiligen Gebote zu übertreten. Immer wenn wir so handeln, ziehen wir uns dein gerechtes Urteil des Verderbens und der Verdammnis zu. Dennoch bereuen wir, dich beleidigt zu haben, und verurteilen uns und unsere Sünden, indem wir dich in wahrer Reue darum bitten, dass deine Barmherzigkeit uns zu Hilfe kommt. Wir bitten dich demütig, unser liebender und barmherziger Vater, dass du dich über uns erbarmst.“
Lasst uns beten, dass Gott uns eine Reformation in unseren Gottesdiensten schenkt, so dass dort der heilige Gott geehrt wird.
4. Gott heiligt uns, indem wir Oberflächlichkeit meiden und die Rechtschaffenheit lieben
Warum ist das so schwierig? Es ist so einfach, in die Fallen der Gesetzlichkeit zu tappen. Es ist einfacher zu sagen: tanzt nicht, geht nicht auf Partys, schaut keine Filme, schließt euer Facebook-, Instagram- usw. -Konto. Es ist einfacher, gegen Homosexualität, Drogen- oder Alkoholkonsum zu predigen.
Aber warum gibt es so selten Predigten gegen Habgier? Weil es einfacher ist, über eine Sünde zu predigen, die äußerlich sichtbar ist.
Aber was ist mit unseren Sünden des Herzens? Was ist mit unserer Liebe zur Oberflächlichkeit? Ich weiß, dass es schwierig ist, zu definieren, was oberflächlich alles beinhaltet. Aber es ist alles, was die heiligen Dinge Gottes irrelevant macht. Wir sind überflutet von belanglosem Gerede. Unser Leben ist voll von irrelevanten Dingen. Wir müssen also dieser Flut von unwichtigen Themen und Gesprächen widerstehen und uns mit heiligen Dingen befassen – mit allem, was vor Gott gut und ausgezeichnet ist. Im übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach! (Phil 4,8)
5. Gott heiligt uns, indem wir uns an die Gnade Gottes erinnern, die uns tröstet
Selbst wenn wir unser Bestes tun, um unserem heiligmachenden Gott zu folgen und um ihm ähnlicher zu werden, sollten wir erkennen, dass es die Gnade Gottes ist, die uns jeden Tag erhält. Unser Stand in Christus, unsere Identität kann uns nicht genommen werden. Wir sind durch das Blut unseres Erlösers gerechtfertigt und geheiligt. Wir sind seine Kinder, auch wenn wir niedergeschlagen sind und wenn unser Leben nicht viel von Gott zeigt. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass unser heiliger Erlöser für ein Volk, wie wir es sind, gekommen ist. Selbst wenn wir fallen und aufstehen, sollten wir uns daran erinnern: Denn ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi (Phil 1,6).
Gyula Bagoly hat in Miskolc/Ungarn und Grand Rapids/USA Theologie studiert und ist Pastor zweier Gemeinden der Reformiert-Presbyterianischen Kirche in Zentral- und Osteuropa. Zudem leitet er eine reformierte Ausbildungsstätte in Budapest. Gemeinsam mit seiner Frau und drei Töchtern lebt er in der Nähe des ungarischen Plattensees.
[1] Der Artikel geht auf einen Vortrag zurück, den Bagoly in englischer Sprache auf dem Reformed Colloquium in Budapest am 26. März 2025 hielt. Für die Übersetzung bedanken wir uns bei Micha Heimsoth.
[2] Anmerkung des Übersetzers: In der deutschen Mainstream-Theologie wird Karl Barth nicht als theologisch Liberaler bezeichnet, sondern als dialektischer Theologe. Der Autor benutzt den Begriff „liberal“ hier also in einem weiteren Sinne.
[3] Vgl. Barth, Karl: Dogmatik im Grundriß. 1947. 9. Auflage. Zürich [Theologischer Verlag Zürich] 2006. S. 40.
[4] Otto, Rudolf: Das Heilige. München [Verlag C.H. Beck] 1971.
[5] Ebd.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Vgl. van Mastricht, Petrus: Theoretical-Practical Theology. Grand Rapids [Reformation Heritage Books] 2019. S. 410.
[9] Vgl. van Mastricht, Petrus: Theoretical-Practical Theology. S. 407.
[10] Vgl. ebd. S. 325.
[11] Vgl. ebd. S. 407.
[12] Vgl. ebd. S. 400.